Wie häuft man ein kleines Vermögen an? Indem man mit einem großen beginnt. Diese alte Erkenntnis will sagen, dass man sorgsam mit einem finanziellen Füllhorn umgehen sollte. Und der Verteidigungsetat 2026 ist ein solches Füllhorn. Zur Einordnung: Mit der Entscheidung, die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse für Verteidigung und Infrastruktur auszusetzen, ergibt sich ein Wehretat in völlig neuer Dimension: 2026 wird ein „Sockelbetrag“ von einem Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung in den Bundeshaushalt eingestellt, alle weiteren Ausgaben darüber hinaus werden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Das „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Mrd. € läuft nach Kalkulationen von Haushaltsexperten 2027 aus. Für den Haushaltsplan 2026, den das Bundeskabinett vor der Sommerpause verabschiedet und dem Parlament zur Bewilligung vorgelegt hat, sind Ausgaben im regulären Einzelplan 14 (Verteidigung) und den Resten des Sondervermögens vorgesehen. Man muss beide Dokumente nebeneinanderlegen.
Der Bundeshaushalt 2026 ist der erste Haushaltsentwurf, der die originäre Handschrift der christdemokratisch-sozialdemokratischen Koalition trägt. Er bildet dramatischen Zuwächse bei der Wehr ab. So heißt es in den Erläuterungen zum „Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2026 und Finanzplan des Bundes 2025 bis 2029“: „Die für den Verteidigungshaushalt vorgesehenen Ausgaben im Regierungsentwurf zum Haushalt 2026 steigen gegenüber dem Finanzplan um rund 29,4 Mrd. € auf rund 82,7 Mrd. €. Mit dem Sondervermögen Bundeswehr wurden insgesamt Mittel in Höhe von 100 Mrd. € bereitgestellt, von denen rund 25,5 Mrd. € 2026 vorgesehen sind.“ Im aktuellen Finanzplan sollen die Verteidigungsausgaben 2029 auf 152,8 Mrd. € steigen.
Im Kapitel 1405 (Militärische Beschaffung) Titel 554 12 (Beschaffung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen, Booten, schwimmendem und sonstigem Marinegerät) sind für 2026 Verpflichtungsermächtigungen/VE (Autorisierung zu langfristigen vertraglichen Bindungen) in Höhe von rund 36,6 Mrd. € bis 2041 ausgewiesen (2027: rund 1,9 Mrd €). Davon unberührt sind einzelveranschlagte Vorhaben (Epl. 14 und Sondervermögen) wie F 126, U 212CD oder Marinebetriebsstoffversorger. Ein Vorhaben F 127 mit einer geschätzten VE in Höhe von zehn Mrd. € könnte ohne Mühe in einen neu einzurichtenden Vorhabentitel überführt werden.
Wahrlich ein Füllhorn, das auch zu Ineffizienz und Verschwendung einlädt. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an einen erfahrenen Haushaltsexperten im parlamentarischen Raum: Schaut nicht auf den Betrag, der zu Jahresanfang zur Verfügung gestellt wird, sondern was am Jahresende nicht ausgegeben ist! Die Gründe für den fehlenden Abfluss von Haushaltsmittel sind vielschichtig: Lieferengpässe, ausbleibende Aufträge und fehlendes Personal (Vertragsjuristen, Abnahmeexperten). Eine ordnende Hand können wir nicht erkennen! Der neue, dritte, Staatssekretär im BMVg kommt aus dem Bundeskanzleramt unter Olaf Scholz und soll Rüstung, Innovation und Cyber verantworten. Allerdings muss er noch das Patent für „Beschaffungsvorhaben auf großer Fahrt“ erwerben.
Die Marine hat einen „Kurs 2025“ abgesteckt und stellt sich dem öffentlichen Diskurs. Wir sind gespannt, wie die parlamentarischen Ausschüsse für Verteidigung und Haushalt die aktuell irritierende Entwicklung beim Vorhaben F 126 und mögliche Konsequenzen für F 127 aufarbeiten und welche Konsequenzen sie fordern. Das Thema braucht einen seriösen Diskurs; er darf nicht erregten Mitgliedern des „Kommentariats“ in den Sozialen Medien überlassen werden.
Dies setzt allerdings belastbare Informationen über die aktuellen NATO-Forderungen (an Deutschland) voraus - ohne dass der notwendige Grad an Vertraulichkeit im Bündnis ignoriert wird. Was erwartet das Bündnis von Deutschland? Welchen konkreten Beitrag soll die Deutsche Marine leisten? Hier muss „Butter bei die Fische“! Im Augenblick gibt es lediglich - mehr oder minder belastbare - Mutmaßungen. Ein solche Gemengelage wird den Herausforderungen und den im Raum stehenden Finanzmitteln nicht gerecht. Sirenenklänge, Beschaffungsforderungen politisch wohlfeil und großzügig „quer durch die Last“ zu befriedigen, sind zu vernehmen. Daher sei hier die Warnung wiederholt: … und führe uns nicht in Versuchung!
Heinz Schulte ist Mitglied des Vorstands des Deutschen Maritimen Instituts.
Heinz Schulte







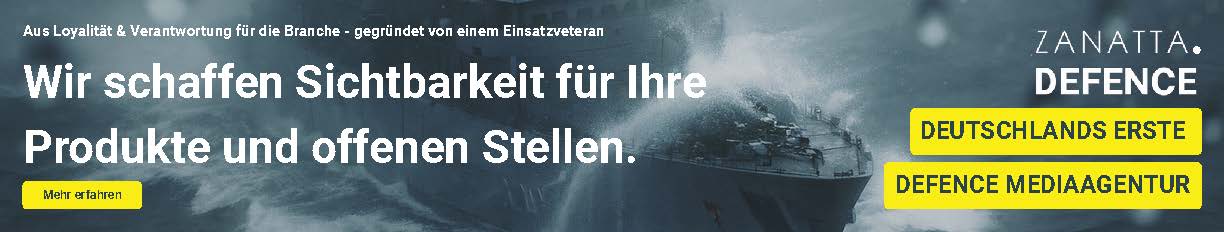



Eine Antwort
Der Artikel von Heinz Schulte trifft einen wunden Punkt der deutschen Sicherheitspolitik: Wir stehen vor einem Füllhorn an finanziellen Mitteln, aber gleichzeitig vor der Versuchung, dieses Geld durch Zögern, bürokratische Ineffizienz oder strategische Unklarheit zu verschwenden. Die zentrale Forderung nach einem „seriösen Diskurs“ ist daher mehr als nur ein Appell – sie ist eine Notwendigkeit. Doch was zeichnet einen solchen Diskurs aus? Er erschöpft sich nicht in der Wiederholung von Fähigkeitslücken oder dem Ruf nach mehr Budget. Ein seriöser Diskurs ist konstruktiv, er bringt konkrete, durchdachte und vor allem machbare Vorschläge auf den Tisch. Er verbindet das strategische Wünschenswerte mit dem technologisch und zeitlich Realisierbaren.
Genau hier setzt der Gedanke an, das „Future Combat Surface System“ (FCSS) nicht als monolithisches Großprojekt zu betrachten, sondern es intelligent aufzusplitten und damit die Einführung unbemannter Systeme massiv zu beschleunigen. Dies soll kein abstraktes Gedankenspiel, sondern ein handfester Vorschlag sein, der den Geist der oft nach getrauerten Schnellboote in das 21. Jahrhundert überführt.
Die Anatomie eines umsetzbaren Vorschlags
Die vorgeschlagene Zweiteilung des FCSS-Programms ist ein Paradebeispiel für proaktiven Pragmatismus:
Die mittelschwere Plattform – Evolution statt Revolution: Die Entscheidung der Marine, im Rahmen der Operationellen Experimentation (OPEX) für das FCSS von Beginn an auf marktverfügbare Systeme zu setzen, ist der einzig richtige und pragmatische Weg. Er untermauert den Ansatz „Evolution statt Revolution“ und vermeidet von vornherein die typischen Risiken einer kompletten Neuentwicklung, die erfahrungsgemäß mit unkalkulierbaren Zeitverzögerungen, Kostenexplosionen und technischen „Kinderkrankheiten“ einhergeht. Ein Konzept wie die norwegische Skjold-Klasse dient hier als exzellentes Beispiel für die Philosophie hinter einem solchen Vorgehen: Man nutzt eine bei einem NATO-Verbündeten erprobte, seetüchtige und schnelle Plattform als Basis. Die Entwicklungsressourcen können sich so voll auf die komplexe Aufgabe der unbemannten Systemintegration konzentrieren. Diese ca. 274 Tonnen schweren unbemannten Einheiten wären das Rückgrat der verteilten maritimen Schlagkraft. Ein erstes Los von 18 Einheiten, den Korvetten der Klasse K130 zugeordnet, würde deren Sensorreichweite und Wirkungsradius exponentiell erhöhen. Die Korvette wird vom Einzelfahrer zum Befehlshaber eines tödlichen Rudels. Ein zweites Los könnte dann operativ den neuen Tendern der Klasse 405 (MUsE) im Verhältnis 1:6 zugewiesen werden und reaktiviert so die bewährte Doktrin der Schnellbootgeschwader in moderner, unbemannter Form.
Die leichte Plattform – Eine geplante Fähigkeit pragmatisch vorziehen: Hierbei handelt es sich nicht um eine neue Forderung, sondern um die konsequente Beschleunigung eines bereits erkannten Bedarfs. Im „Kurs Marine 2025“ ist die Einführung von unbemannten Mehrzweck-Kampfbooten (MZKB) ohnehin bis 2035 geplant. Der Vorschlag, parallel zum FCSS marktverfügbare, leichtere unbemannte Plattformen zu beschaffen, zieht diese essenzielle Fähigkeit um fast ein Jahrzehnt nach vorn. Systeme wie das „CB90 NG mit Autonomous Ocean Core“ sind adaptierbar und könnten die Fähigkeitslücke, die heute bereits offensichtlich ist, zeitnah schließen. Zwanzig solcher Drohnen könnten als erste Welle bei einer Annäherung dienen, um den Gegner niederzuhalten und das Leben der Marineinfanteristen zu schonen. Ihre möglichen weiteren Aufgaben im leichten Begleitschutz der Unterstützungseinheiten oder Objektschutz von etwa Marinestützpunkten und in der „verlusttolerierbar“ Lage-Erkundung sind nicht nur sinnvoll, sondern entlasten auch die hochkomplexen sowie unsere wenigen Fregatten und Korvetten von Aufgaben, für die sie überqualifiziert sind.
Dieses Vorgehen würde den Plan aus „Kurs Marine 2025“ nicht über den Haufen werfen, sondern ihn pragmatisch beschleunigen und mit Leben füllen.
Proaktivität als Bündnisbeitrag: Die Antwort auf die Versuchung
Dies führt uns zur entscheidenden Frage, die der Artikel aufwirft: Auf detaillierte Forderungen der NATO warten oder selbst proaktiv werden? Die Antwort muss ein klares Plädoyer für die zweite Option sein. In einer sich derart schnell wandelnden Bedrohungslage ist das Warten auf einen von 32 Mitgliedern abgestimmten, detaillierten Forderungskatalog der sichere Weg in die strategische Passivität.
Proaktivität bedeutet hier nicht, einen nationalen Sonderweg zu gehen. Im Gegenteil: Es bedeutet, dem Bündnis das anzubieten, was Deutschland schnell und effektiv leisten kann. Es heißt, auf die NATO zuzugehen und zu sagen: „Wir haben die Bedrohung in der Ostsee und im Nordatlantik analysiert. Basierend auf der Technologie unserer Verbündeten können wir bis Anfang 2029 eine schlagkräftige, skalierbare Flotte unbemannter Systeme aufbauen, die die Seeraumüberwachung und -verteidigung voranbringt. Lasst uns gemeinsam definieren, wie wir diese Fähigkeit am besten in die Bündnisverteidigung integrieren.“
Das ist die „Butter bei die Fische“, die Heinz Schulte fordert. Es ist der konstruktive Gegenentwurf zur Versuchung, das Füllhorn des Wehretats entweder nur in prestigeträchtigen Großprojekten versickern zu lassen oder aus reiner Ratlosigkeit gar nicht erst anzutasten. Das bedeutet keineswegs, auf visionäre Vorhaben zu verzichten. Im Gegenteil: Die Forschung und der Projektstart für langfristige Großprojekte wie die Fregatte F127 oder im Besonderen die zukünftigen Large Remote Missile Vessels (LRMV) müssen bereits jetzt beginnen, denn dies sind Marathonläufe und keine Sprints wie das hier skizzierte FCSS. Ein seriöser Diskurs, gepaart mit dem Mut zu pragmatischen und schnellen Lösungen, ist der einzige Weg, um aus dem Geld eine Fähigkeit und aus der Fähigkeit einen relevanten Beitrag für unsere eigene Sicherheit und die unserer Verbündeten zu machen.
Bleibt am Ende nur die Frage, ob dieses Schriftwerk hier nun selbst ein Teil des geforderten „seriösen Diskurses“ ist – oder am Ende doch nur eine weitere Stimme aus dem „Kommentariat“, das der Autor kritisiert.